Long Covid und Homöopathie
- Timo Trachsel

- 18. Aug. 2025
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Aug. 2025
Interview zwischen Selina Schöpfer (Autorin) und Timo Trachsel (Homöopath)
Viele Long-Covid-Patient:innen fühlen sich alleine gelassen. Ihre Symptome sind diffus, ihr Alltag eingeschränkt – und oft stossen sie auf Unverständnis. Homöopath Timo Trachsel erzählt im Interview mit Selina Schöpfer, was es heisst, wirklich zuzuhören, wie individuelle Heilung aussehen kann und warum Schul- und Komplementärmedizin einander näherkommen müssen.
Sie haben Ihre Ausbildung mitten in der Corona-Zeit gemacht. Wie hat sich das damals auf Ihren Unterricht oder auf inhaltliche Schwerpunkte ausgewirkt?
Es ging eigentlich gar nicht mehr so sehr um klassische Schulmedizin, sondern stark um Corona. Wir haben das Virus mal richtig analysiert – wie ist es aufgebaut, woraus besteht es überhaupt? Zellkern, Zell-DNA und so weiter.
Haben Sie auch über mögliche Behandlungen gesprochen?
Am Anfang gar nicht. Da dachte man ja noch: „Okay, Corona dauert ein, zwei Monate, dann ist die Welt wieder in Ordnung.“ Erst später, so ab Herbst 2021, als sich die Lage etwas beruhigt hat, kam das Thema langsam auf. Da wurde dann auch sichtbar: Die Leute kommen aus dem Lockdown zurück – und bringen ihre Fragen mit.
Haben Sie in der Praxis die Corona-Welle gespürt?
Ja, schon. Während Corona waren die Leute sehr vorsichtig – Masken, Desinfektion, alles. Viele hatten auch Angst, überhaupt wieder in eine Praxis zu gehen, weil da andere Kranke sind. Es war also deutlich ruhiger als sonst. Aber als die Corona-Wellen abflauten, kamen die Leute nach und nach zurück – und zwar mehr als vorher. In der Naturheilpraxis hatten wir sicher 20 bis 30 Prozent mehr Patient:innen als vor der Pandemie. Und dann kam noch Long-Covid dazu.

Wie nehmen Sie die Menschen wahr, die mit Long-Covid zu Ihnen kommen – was bewegt sie besonders?
Viele Long-Covid-Betroffene fühlen sich total alleine. Oft lange nicht ernst genommen, abgeschoben. Obwohl man heute weiss, dass Symptome auch Monate nach der Infektion auftreten können – es bleibt irgendwie ein Tabuthema. Gerade das Nicht-Ernstnehmen kann eine gute Rekonvaleszenz verhindern – und das kippt dann leicht Richtung Long-Covid. Man muss zuhören. Ohne zu werten. Und die Leute ernst nehmen – egal, welche Symptome sie haben. Da haben wir alle noch Potenzial. Ich genauso.
“Viele Long-Covid-Betroffene fühlen sich total alleine. Oft lange nicht ernst genommen, abgeschoben.”
Gibt es ein allgemeines Vorgehen oder ein Erfolgsrezept bei Long-Covid?
Nicht wirklich. Long-Covid ist sehr individuell. Was man oft sieht, ist diese bleierne Müdigkeit und eine langsame Genesung. Viele klagen über Atemnot, Schwindel, Herzrhythmusstörungen oder auch Reizempfindlichkeit – Geräusche, Licht, alles ist zu viel. Aber eine Standardbehandlung gibt es nicht. Jeder Mensch bringt andere Symptome mit, jede:r reagiert anders – da muss man sehr individuell arbeiten. Es geht selten linear vorwärts – eher in Wellen. Du machst einen Schritt nach vorne, dann geht’s mal 20 Prozent besser – und dann kommt wieder ein Monat, der schwierig ist, und du fällst wieder etwas zurück. Es ist ein langwieriger, zäher Prozess. Schritt für Schritt.
“Eine Standardbehandlung gibt es nicht.”
Wie gehen Sie damit um, wenn eine homöopathische Behandlung bei jemandem nicht anschlägt?
Es gibt immer wieder Menschen, die auf die homöopathische Behandlung nicht ansprechen. Aber wir haben in unserer Praxis den Luxus, dass wir verschiedene Möglichkeiten anbieten können. Wir arbeiten eng mit Hausärzt:innen zusammen. In unserer Gemeinschaftspraxis gibt es zudem Akupunktur, TCM, Craniosacraltherapie, Kinesiologie... All das kann genauso helfen.
“Bei uns geht es um den ganzen Menschen.”
Long-Covid wird ja oft auch schulmedizinisch behandelt. Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied zur homöopathischen Herangehensweise?
Zuerst mal finde ich es wirklich gut, dass die Schulmedizin Long-Covid mittlerweile anerkennt. Lange wurde das Thema einfach abgetan oder sogar ins Lächerliche gezogen – obwohl man weiss, dass es diese Phase der Rekonvaleszenz gibt. Aber klar, die Schulmedizin arbeitet stark symptomorientiert. Wenn jemand z. B. sagt: „Ich bin einfach erschöpft, vielleicht auch depressiv seit Long-Covid“, dann wird da schnell mal ein Antidepressivum verschrieben. Bei uns geht es um den ganzen Menschen. Wir schauen nicht nur auf die Depression oder die Erschöpfung – sondern auch: Gibt es Herzrhythmusstörungen? Gibt’s andere körperliche oder seelische Begleiterscheinungen? Je näher wir am Menschen als Ganzes sind, desto eher können wir ihm langfristig helfen – und nicht nur die Symptome wegdrücken.

Gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und Homöopathie?
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei Long-Covid ist das zentral – viele Betroffene haben auch chronische Erkrankungen wie Lungenfibrose oder Osteoporose mit Gelenkschmerzen. Das wird oft vergessen. Da braucht es manchmal schulmedizinische Medikamente, um Symptome zu stabilisieren oder zu lindern. Unsere homöopathische Behandlung kann dann parallel dazu fürs Gesamtwohl sorgen. Ich finde, diese Kombination funktioniert wunderbar – wenn beide Seiten offen sind.
Indien oder Südafrika zum Beispiel – das finde ich richtig toll. Dort haben alle die gleiche medizinische Grundausbildung, egal ob Homöopath:in oder Schulmediziner:in. Das ist für mich das Ideale: Man versteht sich auf Augenhöhe, weil man dieselbe Sprache spricht. Und ich denke, genau da müsste man bei uns auch ansetzen – schon in der Ausbildung. Wir Homöopath:innen haben über 3’000 Stunden medizinische Ausbildung. Wieso nicht auch umgekehrt? In den sechs Jahren Medizinstudium könnten ja wenigstens 50 Stunden Homöopathie oder andere alternative Therapien vermittelt werden. Das würde schon viel verändern.
“Die Patient:innen selbst sind die beste Messinstanz.”
Wie wird in der Homöopathie beurteilt, ob eine Behandlung wirkt? Gibt es objektive Kriterien?
Meistens nicht. Bei chronischen Erkrankungen oder Long-Covid schauen wir uns aber auch messbare Parameter an – zum Beispiel das Lungenvolumen oder den Sauerstoffgehalt. Wenn jemand etwa über Atemnot klagt, kann man den Verlauf durch solche Werte objektiv nachvollziehen. Aber vieles, gerade auf emotionaler oder psychischer Ebene, geht nur über das subjektive Empfinden. Wir arbeiten da mit regelmässigen Rückmeldungen. Die Patient:innen selbst sind da die beste Messinstanz. Dabei geht es nicht nur um einzelne Symptome, sondern auch um das allgemeine Wohlbefinden: Vitalität, Lebensqualität und seelisches Gleichgewicht sind wichtige Gradmesser für den Behandlungserfolg.
“Wenn’s wirkt, dann wirkt’s. Und zwar über alle Ebenen hinweg.”
Gerade an diesem Punkt wird Homöopathie oft kritisiert – Stichwort Placebo. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
Also ehrlich gesagt: Der grösste Placebo-Effekt ist wahrscheinlich der weisse Kittel. Der allein kann schon Vertrauen schaffen und bei vielen bewirken: „Ah, jetzt wird’s besser.“ Das gilt für alle Bereiche – auch in der Schulmedizin. Was die Homöopathie betrifft: Klar, es wird oft gesagt, sie sei nicht mehr als Placebo. Aber dann frage ich: Wie erklären wir, dass Homöopathie bei Tieren, bei Kindern oder sogar bei Pflanzen wirkt? Die kennen kein Placebo – und trotzdem sehen wir: Sie erholen sich, wachsen besser, Krankheiten verschwinden. Auch diverse Studien des Berner Forschers Prof. Dr. sc. nat. Stephan Baumgartner zeigen auf: Homöopathie wirkt über den Placeboeffekt hinaus. Für mich ist klar: Wenn’s wirkt, dann wirkt’s.

Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Homöopathie in der Schweiz besser unterstützt wird?
Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und alternativen Methoden wie Homöopathie oder andere alternative Therapien hat definitiv zugenommen. Und ich bin überzeugt, das wird weiter wachsen – einfach, weil man merkt: Homöopath:innen haben heute eine solide medizinische Grundausbildung. Das ist wichtig, um einschätzen zu können, was man behandeln kann – und was eben nicht. Wenn Ärzt:innen merken, du hast wirklich Ahnung und kannst den Zustand eines Patienten korrekt einschätzen, dann arbeiten sie auch gerne mit dir zusammen. Ich glaube, was es noch mehr braucht, ist gegenseitiges Verständnis. Zuhören können, offen sein für neue Methoden. Und: mehr Unterstützung für die Forschung. Fördergelder oder Bundesbeiträge wären wichtig, um Studien weiter auszubauen und sichtbar zu machen, dass Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus wirkt.
“Wenn wir aufhören, nur zu reparieren – und anfangen, wirklich zuzuhören – dann beginnt echte Heilung.”
Wenn Sie sich etwas für das Schweizer Gesundheitssystem wünschen könnten – was wäre Ihnen persönlich wichtig?
Ich wünsche mir, dass es keine Tabus mehr gibt – in keine Richtung. Dass wir offener werden. Mehr Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und alternativen Methoden – das wäre für mich ein echtes Zeichen von Entwicklung. Und ja, auch Themen wie Impfnebenwirkungen sollten kein Tabu mehr sein. Man weiss zum Beispiel, dass Herzmuskelentzündungen auftreten können – aber während Corona wurde das oft einfach abgestritten. Transparenz schafft Vertrauen. Auch Fehler sollten offen kommuniziert werden – auf allen Seiten. Und insgesamt: Mehr Rücksicht. Auf andere – und auch auf sich selbst. Wenn wir aufhören, nur zu reparieren – und anfangen, wirklich zuzuhören – dann beginnt echte Heilung.
Das wünsche ich mir für die Schweiz, für unser Gesundheitssystem und für uns als Gesellschaft
Autorin: Selina Schöpfer - Sommer 2025

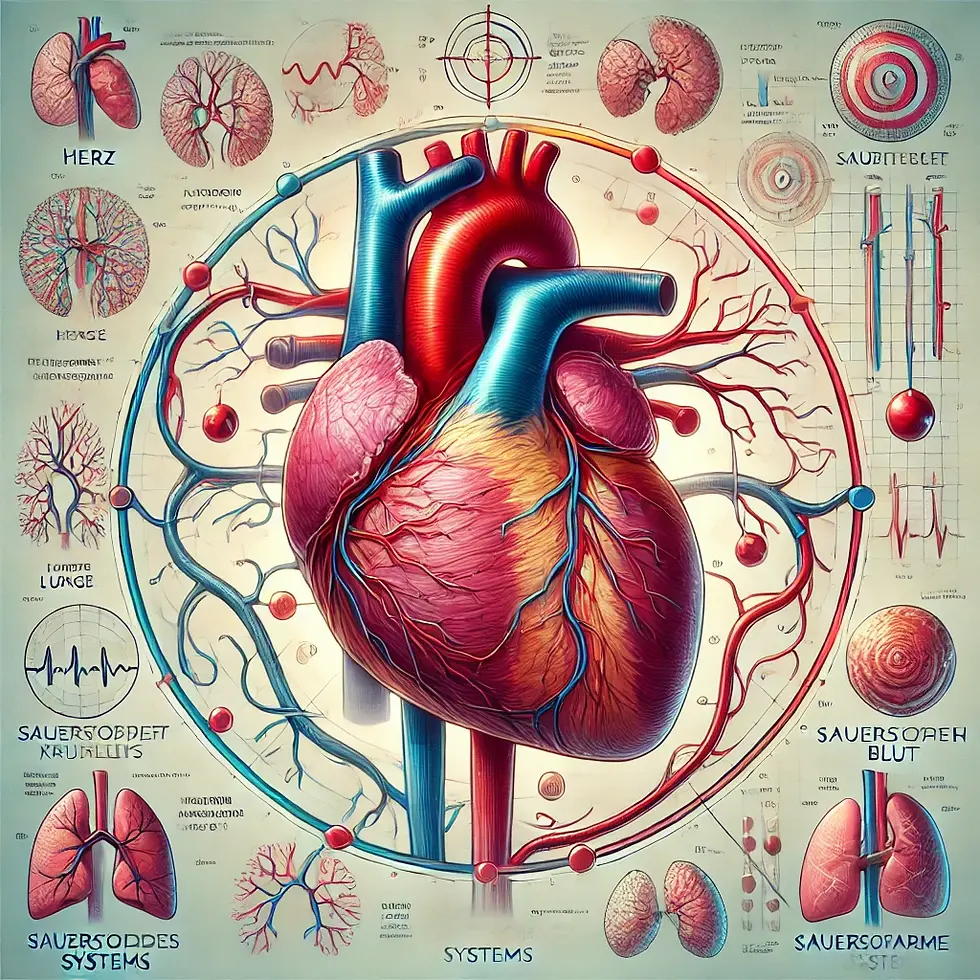


Bravo, grazie mille per il suo lavoro, signor Trachsel.
Wow wie schön Herr Trachsel. Würden doch alle anderen Personen und unsere Politiker auch so denken wie Sie.
Schön zu hören. Es ist toll, dass es noch Therapeuten gibt, die Ihre Patienten ernst nehmen undd empathisch und proaktiv handeln. Gerade das Thema Long Covid wird sonst nie richtig ernst genommen und deshalb habe ihr Interview sehr herzlich empfunden. Danke Herr Trachsel! Und auch gute Fragen von der Autorin